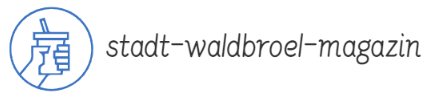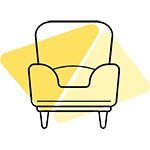

Sprache transportiert Klischees, auch in Stellenanzeigen. Facebook
- Von stadt-waldbroel-magazin/li>
- 637
- 07/08/2022
Hand aufs Herz: Wie stellen Sie sich einen Ingenieur vor? Sollten Sie an einen Mann im Karohemd denken, sind Sie nicht allein. Wie sonst erklärt sich, dass die amerikanische Ingenieurin Isis Wenger kürzlich eine Lawine lostrat, als sie unter dem Twitter-Hashtag #iLookLikeAnEngineer ein Foto von sich postete? Innerhalb kürzester Zeit tauchten unter demselben Stichwort Tausende Nachrichten und Bilder internationaler Berufskolleginnen auf. Ihre Botschaft: Nicht nur weiße Männer, sondern Menschen jedes Geschlechts und jeder Hautfarbe arbeiten in technischen Berufen.
Unternehmen unterschätzen die Wirkung von Stereotypen
Mögen Stereotype oder Vorurteile mitunter subjektiv zutreffen, die tatsächlichen Präferenzen unterschiedlicher Menschen können sie nicht abbilden, weil sie den Blick auf Ausnahmen versperren. Wie hartnäckig sie sich dennoch quer durch alle Gesellschaftsschichten halten, führt das Aufsehen um die Fotoaktion vor Augen.
Nicht nur Bilder, auch Sprache spielt bei Stereotypisierungen eine entscheidende Rolle. Oft genügt ein einzelnes Stichwort, um ein bestimmtes Bild vor Augen zu rufen, ein Gefühl zu erzeugen oder eine Handlung auszulösen. Was im Internet kurzzeitig Aufsehen erregt, kann Unternehmen nachhaltig schaden. In ihren Bemühungen, die Vielfalt zu steigern und mehr Führungspositionen mit Frauen zu besetzen, unterschätzen oder übersehen Unternehmen die Wirkung von Stereotypen. So verwenden Stellenanzeigen zum Beispiel Bilder, Formulierungen und Worte, die das stereotype Bild vom hemdsärmeligen Manager nachzeichnen – und damit auch vorgeben. Nicht nur Frauen, auch Menschen, die nicht aus Deutschland kommen oder sich durch andere Merkmale vom Stereotyp unterscheiden, fällt es schwer, sich mit der gesuchten Stelle zu identifizieren. Daran ändert auch ein dem Jobtitel pflichtschuldig hinzugefügtes „(m/w)“ nichts. Das mag den Bestimmungen des „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG) genügen, wertschätzend angesprochen fühlen sich Frauen davon nachweislich nicht.

"Agentische" Begriffe sprechen eher Männer an
Auf welche Formulierungen Frauen besser ansprechen, konnte ein Forschungsteam der TU München nachweisen. Bei der sprachlichen Analyse von Stellenanzeigen zeigte sich, dass Annoncen für Positionen mit hohem Männeranteil vermehrt aufgaben, leistungs und führungsorientierte Formulierungen wie „durchsetzungskräftig“ und „ehrgeizig“ verwendeten – sogenannte agentische Begriffe. Die männlichen Studienteilnehmer fühlten sich davon angesprochen, weibliche dagegen kaum. Sie bevorzugten in den Tests alternativ formulierte Anzeigentexte, die mehr beziehungs und gemeinschaftsorientierte Formulierungen enthielten – „kommunale“ Formulierungen. Dazu gehörten Worte wie „kommunikativ“, „kooperationsfähig“, „teambildend“, „diplomatisch“ und „motivierend“. Überraschende Erkenntnis: Die kommunal formulierte Stellenanzeige sprach ebenfalls die Männer an und motivierte darüber hinaus die Frauen stärker, sich zu bewerben.
Für Unternehmen könnten diese vermeintlichen Feinheiten einen gewaltigen Unterschied machen. Die Münchner Studie kommt zu dem Ergebnis, dass bereits die Formulierung einer Annonce darüber entscheidet, ob eine Frau oder ein Mann am Ende eine Führungsposition besetzen. Denn fühlten sich Frauen nicht angesprochen, ist das Fazit, meldeten sie sich erst gar nicht. „Stellenanzeigen, die viele agentische Formulierungen aufweisen, sprechen Frauen im Durchschnitt weniger an als Männer“, sagt Tanja Hentschel vom Forschungsteam der TUM. „Viele Unternehmen sind sich nicht bewusst, dass sie mehr Frauen von einer Bewerbung auf eine Führungsposition überzeugen könnten, wenn ihre Anzeigen kommunale Begriffe enthielten – eben solche kommunalen Eigenschaften, die auch tatsächlich für viele Führungspositionen von zentraler Bedeutung sind.“
Bewerberinnen möchten, dass ihre Stärken geschätzt werden
Aus Sicht der Psychologin ist der Grund für die negativen Effekte agentischer Begriffe nicht etwa, dass sich Frauen die Stelle nicht zutrauten. „Sie haben vielmehr das Gefühl, mit ihren Fähigkeiten und Stärken nicht zu dem Unternehmen und dem Job zu passen, und bewerben sich deshalb auch nicht“, sagt Hentschel. Wer will schon arbeiten, wo die persönlichen Stärken nicht geschätzt werden?
Effektiver ist also eine Sprache, die Stereotypen auflöst und auf die Präferenzen ihres Adressatenkreises eingeht. Das ist aufwändig, denn es heißt, Merkmale wie Geschlecht, Alter, Herkunft, sexuelle Orientierung und Religion in die Gestaltung einzubeziehen. Schematische Lösungen konnten sich bislang nicht durchsetzen. Konstruktionen wie „Student/innen“, „Mitarbeiter_innen“ oder „ProfessX“, die unterschiedliche Geschlechter gleichermaßen ansprechen sollen, gelingt das nicht. Sie werden allgemein als künstlich, umständlich und nicht alltagstauglich empfunden.
Kombinierte Strategien, die mit der Nennung beider Geschlechter („Projektleiter und Projektleiterin“), alternativen Wortformen („Mitarbeitende“ statt „Mitarbeiter“), Versachlichungen („Kundschaft“ statt „Kunde“) in der Kombination mit den genannten kommunalen Formulierungen arbeiten, sind dagegen vielversprechend.
Alle potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten sollen sich angesprochen fühlen
Die passgenaue Ausrichtung ist mitunter kniffelig, verspricht letzten Endes jedoch eine optimale Personalsuche und -auswahl. Sie stellt sicher, dass sich alle potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten angesprochen fühlen und aus ihnen die Besten ausgewählt werden können. Unternehmen, die auf seit Generationen bewährte Weise nach Talenten und Fachkräften suchen, vergeben darüber hinaus die Chance, ihre Jobannonce als Visitenkarte zu nutzen und sich als ein offenes Unternehmen, das Vielfalt schätzt, zu präsentieren. Und das gilt nicht nur für Stellenanzeigen, sondern auch für die Kommunikation mit Kundschaft, Geschäftspartnerinnen und- partnern, Stakeholdern und Mitarbeitenden. Denn welche Kreise ein vermeintlich kleines Statement ziehen kann, zeigt schon der Twitter-Hashtag einer Ingenieurin gegen angestaubte Vorurteile.Hans Jablonski ist Diversity-Experte und Berater, Tobias Neuhaus ist Redakteur und PR-Berater. Dieser Text erschien in der Beilage zur Diversity-Konferenz 2015 des Tagesspiegels. Mehr zum Thema Diversity lesen Sie hier.